Im ersten Moment sei er etwas pikiert gewesen, sagt der Schweizer Insektenforscher Charles Lienhard. Doch dann habe ihn sein japanischer Kollege davon überzeugt, dass es eine Ehre sei, mit dem Ig-Nobelpreis ausgezeichnet zu werden. Der Preis gilt als «Anti-Nobelpreis» und wird seit 1991 jedes Jahr in einer humoristischen Veranstaltung verliehen, seit 2001 an der Harvard University. Man kann das englische «ignoble» mit «schmachvoll» übersetzen. Aber als Schmach ist die Auszeichnung nicht gedacht. Sie wird für Erkenntnisse verliehen, «die einen erst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringen».
Insgesamt wurden dieses Jahr zehn Preise in den Gebieten Physik, Frieden, Wirtschaft, Anatomie, Biologie, Fluiddynamik, Ernährung, Medizin, Kognition und Geburtshilfe verliehen. Bei zwei Preisen waren Schweizer Forscher massgeblich beteiligt. So erhielten Lienhard und seine Kollegen aus Japan und Brasilien den Biologiepreis. Sie hatten gezeigt, dass brasilianische Höhleninsekten der Gattung Neotrogla bezüglicher ihrer Geschlechtsorgane einzigartig sind: Die Weibchen tragen einen Penis und die Männchen eine Vagina. Die Arbeit warf viele Fragen auf und sorgte auch bei Laien für lange Diskussionen. Zum Beispiel darüber, ob ein Weibchen mit einem Penis ein Männchen sei. Für die Wissenschafter war diese Frage klar zu beantworten. Das Weibchen sei dasjenige, das die grösseren Keimzellen, die Eizellen, trage, sagt Lienhard.
Didgeridoo-Spielen hilft bei obstruktiver Schlafapnoe
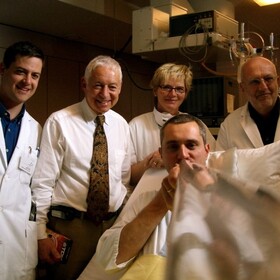 Auch der Ig-Friedensnobelpreis geht dieses Jahr an Schweizer. Die Forscher unter der Leitung von Otto Brändli von der Höhenklinik Wald zeigten 2005, dass regelmässiges Didgeridoo-Spielen die Beschwerden von Menschen mit obstruktiver Schlafapnoe verbessert. Sie schnarchten weniger und waren tagsüber weniger müde. Beides dürfte das friedliche Zusammenleben in einer Partnerschaft durchaus fördern. Die obstruktive Schlafapnoe entsteht, wenn die Muskulatur in den oberen Atemwegen im Schlaf erschlafft und die Atmung stört. Das führt zu kurzen Atemaussetzern, auf die jeweils ein lauter Schnarcher folgt, wenn der Schlafende nach Luft ringt.
Auch der Ig-Friedensnobelpreis geht dieses Jahr an Schweizer. Die Forscher unter der Leitung von Otto Brändli von der Höhenklinik Wald zeigten 2005, dass regelmässiges Didgeridoo-Spielen die Beschwerden von Menschen mit obstruktiver Schlafapnoe verbessert. Sie schnarchten weniger und waren tagsüber weniger müde. Beides dürfte das friedliche Zusammenleben in einer Partnerschaft durchaus fördern. Die obstruktive Schlafapnoe entsteht, wenn die Muskulatur in den oberen Atemwegen im Schlaf erschlafft und die Atmung stört. Das führt zu kurzen Atemaussetzern, auf die jeweils ein lauter Schnarcher folgt, wenn der Schlafende nach Luft ringt.
Nachdem ein Didgeridoo-Lehrer und Patient der Ärzte in der Höhenklinik Wald festgestellt hatte, dass seine Beschwerden durch regelmässiges Didgeridoo-Spielen verschwunden waren, untersuchten die Forscher dies systematisch in einer Studie mit vielen Probanden. Tatsächlich stellten sie eine erhebliche Verbesserung der Beschwerden fest, wenn die Probanden sechs Tage pro Woche 25 Minuten lang spielten. Vermutlich stärke das Training die Muskulatur in den Atemwegen, sagt Brändli.
Im Rahmen einer Show hielt jedes geehrte Team am Donnerstag eine kurze Ansprache – teilweise per Videobotschaft – und bekam eine 10-Billionen-Dollar-Note aus Simbabwe überreicht.
Lungenkranke mit COPD, einer der häufigsten Todesursachen in der Schweiz, leiden darunter, dass ihre Krankheit in der Bevölkerung zu wenig bekannt ist oder als selbst verschuldete „Raucherlunge“ bezeichnet wird.
Auch die Luftverschmutzung durch Feinstaub sollte als Ursache bekämpft werden. Dank Früherkennung mit Fragebogen und Lungenfunktionsmessung können die kosteneffizientesten Massnahmen wie Raucherentwöhnung, Inhalationstherapie und selbständiges Körpertraining eine Verbesserung der Lebensqualität bewirken. Mit pulmonalen Rehabilitationsprogrammen kann die Mitarbeit der Patienten, insbesondere zur der Vermeidung von teuren COPD- Exazerbationen, verbessert werden.
{slider=COPD bekannter machen}
COPD ist eine wenig populäre Bezeichnung für die dritthäufigste Todesursache weltweit, an welcher auch in der Schweiz über 400‘000 Menschen leiden und jedes Jahr mehr als 4000 sterben (Abb.1)! COPD ist ein neuer Name für eine alte Krankheit, die im Volksmund wegen des Schleimabhustens „Katarrh“ hiess (altgriechisch καταρρεϊν = herunterfliessen). Während die Engländer von „Bronchitis“ sprachen, nannten die Amerikaner die Krankheit „Lungenemphysem“. Erst in den 1960er Jahren kam wegen der einfacher gewordenen Messung der obstruktiven Lungenfunktion der Begriff „COPD“ erstmals auf. Leider kann dieser in der Bevölkerung wenig bekannte Begriff nicht einfach durch die Bezeichnung „Raucherlunge“ ersetzt werden, weil man damit etwa 20% der Erkrankten sehr Unrecht täte, die selber nie geraucht haben. Ausdrücke wie „Feinstaublunge“ oder „vorzeitige Lungenalterung“ kommen der Pathophysiologie der Krankheit näher: durch die Entzündung der Bronchien und den fortschreitenden Verlust der Gasaustauschfläche fallen die anfänglich über 300 Millionen Alveolen „wie Blätter vom Lungenbaum“.
Alle Anstrengungen, die COPD in unserer Bevölkerung bekannter zu machen, helfen den Betroffenen und ihren Angehörigen, die Krankheit besser zu verstehen und mehr Verständnis für ihre Leistungsdefizite zu bekommen, und allgemein auch Verständnis für die notwendigen Luftreinhalte- und Tabakpräventionsmassnahmen zu wecken.
COPD- Ursachen bekämpfen
Neben dem Zigarettenrauchen und Passivrauch ist heute bei uns die verunreinigte Atemluft durch Staubbelastung, weniger am Arbeitsplatz als an vielbefahrenen Strassen, die Hauptursache. Massnahmen wie Raucherregelungen und Abgasvorschriften lindern die Symptome der COPD- Kranken und verlangsamen ihre Krankheitsprogredienz [1]. So sind nicht nur die Herzinfarkte, sondern auch Hospitalisationen wegen COPD zeitgleich mit der Einführung der Rauchstopps im öffentlichen Raum in den einzelnen Schweizer Kantonen zurückgegangen [2].
Alle Patienten sollten regelmässig nach ihren Rauchgewohnheiten befragt werden. Den Rauchenden sollen Raucherentwöhnung und medikamentöse Unterstützung dabei angeboten werden. In einer grossen randomisierten Studie über 14 Jahre (Lung Health Study) konnte gezeigt werden, dass die Raucherentwöhnung allein eine signifikante Lebensverlängerung bewirkt [3] (Abb.2).
COPD Patienten und ihre Angehörigen sollten jährlich gegen Grippe geimpft werden. Allen Patienten, insbesondere in den fortgeschrittenen COPD- Stadien 3 und 4 nach GOLD und im Alter über 65 Jahren, soll die einmalige, allerdings bis jetzt leider noch nicht von allen Krankenkassen bezahlte, Impfung mit dem 13-valenten konjugierten Impfstoff Prevenar13® gegen Pneumokokken (anstelle des weniger wirksamen Pneumovax®) empfohlen werden.
{slider=COPD früher erkennen}
Obwohl ein ungezieltes Screening von Gesunden mittels Lungenfunktion nicht empfohlen wird, können Fragebogen als COPD- Risikotest helfen, die Krankheit frühzeitig zu diagnostizieren (http://www.lunge-zuerich.ch/wissen/copd/copd-risikotest/ oder http://www.lungenliga.ch/nc/de/krankheiten-ihre-folgen/copd/diagnose/copd-risikotest.html). Bis zu 50% der Rauchenden haben bereits Symptome der COPD aber noch eine normale Lungenfunktion [4]. Da Lungenfunktionsmessungen in der Grundversorgerpraxis leider oft fehlen, werden viele COPD Patienten leider erst spät oder gar nicht diagnostiziert. Bei Patienten mit Symptomen oder beruflicher Exposition (zum Beispiel Landwirte), mit Alpha-1-Antitrypsin-Mangel (ein Gendefekt bei 1-2 % der COPD-Patienten, meist mit Krankheitsbeginn vor dem 40. Altersjahr) und Rauchenden im Alter von über 40 Jahren sollte regelmässig mit den heute einfach zu bedienenden elektronischen Geräten (zum Beispiel dem in der Schweiz entwickelten EasyOne® der Firma www.ndd.ch) eine Spirometrie durchgeführt werden.
{slider=Mehr Kompetenzen für die Patienten}
Da es sich bei COPD um eine chronische, medikamentös nicht heilbare Krankheit handelt, ist die Mitarbeit der Patienten entscheidend: insbesondere bei der Raucherentwöhnung, der regelmässigen Inhalationstherapie und beim körperlichen Training und der pulmonalen Rehabilitation, den vier wirksamsten und kosteneffizientesten Therapiemassnahmen bei COPD. Die Analogie zur Langzeitbehandlung der Hypertonie ist frappant (Abb.3): Die wiederholte Lungenfunktionsmessung kann ähnlich wie die Blutdruckmessung den Krankheitsverlauf objektivieren und dem Patienten vor Augen führen. Sie ist im Gegensatz zur Blutdruckmessung auch im TARMED verrechenbar. Sie ist wie die Messung der Sauerstoffsättigung am Finger mit immer kleineren und einfacheren Geräten auch vom Patienten selber zu Hause durchführbar und kann mittels Smartphone dem Arzt übermittelt werden.
Die Zahl der zur Inhalationstherapie angebotenen Geräte nimmt ständig. Es ist deshalb von Vorteil, jeweils das gleiche Gerät für alle Therapieformen (Anticholinergika, Sympathomimetika, Steroide) zu verwenden, mit welchem Arzt und Patient vertraut sind. Seit kurzem gibt es auch die Möglichkeit, den Patienten regelmässig zur Benützung seines Inhalationsgerätes dank einem eingebauten Testsystem (zum Beispiel dem Smartinhaler Turbu+®, ab Januar 2017 gratis von AstraZeneca erhältlich) mit einem Smartphone- App aufzufordern. Damit kann der behandelnde Arzt auch die Therapietreue überwachen. So kann die gemäss Untersuchungen allgemein sehr schlechte Compliance bei der Inhalationstherapie verbessert werden.
Ganz entscheidend aber ist die Mitarbeit der Patienten bei der Verhinderung von schweren Exazerbationen und bei deren kosteneffizienten, möglichst ambulanten Behandlung. Hier sind inpiduelle Aktionspläne wie diejenigen des „praktischen Leitfadens für Betroffenen und Angehörige der Lunge Zürich“ sehr hilfreich (“besser Leben mit COPD“ nach dem Programm der McGill Universität in Montreal, erhältlich beim Verein Lunge Zürich, Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zürich, Tf 0800070809 oder
Selbständig trainieren dank pulmonaler Rehabilitation
COPD ist auch eine Systemerkrankung mit Muskelschwund durch Trainingsmangel, mit Gewichtsverlust und einer systemischen Entzündung mit Folgen auch für das Gefässsystem. Vor allem aber verursacht die zunehmende Atemnot eine verminderte Aktivität und leitet einen Teufelskreis mit immer grösserer werdender Angst, Depressionen und Isolation ein. Dieser kann mit einem speziellen Trainingsprogramm, idealerweise in Gruppen, und insbesondere auch nach Exazerbationen durchbrochen werden. Solche Programme können anfänglich als stationäre, später und in vielen Fällen schon von Anfang als ambulante pulmonale Rehabilitation durchgeführt werden. Zur Beurteilung der körperlichen Leistungsfähigkeit empfehlen wir anstelle des aufwendigeren 6- Minuten- Gehtests den „Sit-to-Stand Test. Dabei wird während nur einer Minute die Anzahl Sitz- und Stehabfolgen auf einem Stuhl ohne Lehne gezählt, die der Patienten maximal leisten kann. Lungengesunde erreichen dabei bis zu 40 und mehr Wiederholungen in der Minute [6].
Diese pulmonalen Rehabilitationsprogramme werden leider noch viel zu wenig verordnet. Sie sind sogar kosteneffizienter als die medikamentöse Therapie! Überall in der Schweiz haben Lungenärzte und Spitäler solche Programme aufgebaut. Sie werden von der Kommission pulmonale Rehabilitation und Patientenschulung der Schweizerischen Gesellschaft für Pneumologie akkreditiert und überwacht. Diese führt auch ein Verzeichnis der anerkannten Zentren (http://www.pneumo.ch/de/kommissionen-und-arbeitsgruppen/kommission-pulmonale-rehabilitation-und-patientenschulung/anerkannte-zentren.html). Während die stationäre pulmonale Rehabilitation meist auf zwei bis drei Wochen und die ambulante auf drei Monate beschränkt bleiben und kassenpflichtig sind, können ambulante Anschlusstrainings in Lungensportgruppen den Krankheitsverlauf nachhaltig günstig beeinflussen. Lungenligen bieten solche Angebote, an deren Kosten sich die Zusatzversicherungen teilweise beteiligen. Viele COPD Patienten besuchen auch mit Erfolg regelmässig ein Fitnesscenter für ihr selbständiges Kraft- und Ausdauertraining.
{slider=Lebensende besprechen}
COPD Kranke haben Angst, mit schwerer Atemnot ersticken zu müssen. Aus meiner Erfahrung ist das jedoch nur sehr selten der Fall. Meist sterben sie an ihren Komorbiditäten wie Herzerkrankungen oder an Lungenkrebs. Dank Heimsauerstofftherapie und kontrollierter terminaler Sedation kann ihnen ein Erstickungstod erspart werden. Wichtig ist jedoch die frühzeitige Abfassung einer Patientenverfügung mit Angaben über Reanimations- und Beatmungswünsche, insbesondere während einer Exazerbation. Sehr hilfreich ist dabei der Einbezug der Bezugspersonen, welche oft wegen der Husten- und Atemnotsymptomatik der Kranken sehr mitleiden müssen [7].
{slider=Merkpunkte}
{slider=Lernfragen zu: die Folgen vom Rauchstopp (welche Antwort ist falsch?) }
Seit Inkrafttreten des Rauchstopps im öffentlichen Raum ist in der Schweiz nachweislich folgendes eingetreten:
{slider=Antwort: zu: folgen vom Rauchstopp}
Einzig Antwort 4 ist falsch: gemäss einer erst nach Einsendung publizierten Auswertung der Schweizer Spital- und Todesursachenstatistik ist zwar die Zahl der Hospitalisationen wegen Herzinfarkten und COPD signifikant zurückgegangen, bisher noch nicht jedoch die der COPD- Todesfälle. Die Zahl der Rauchenden ist leider nicht weiter zurückgegangen: 2015 rauchen 25,0% der Bevölkerung, gegenüber 24,9% im Jahr 2014; 2013: 25,0%; 2012: 25,9%; 2011: 24,5% (http://www.bag.admin.ch/suchtmonitoring/14446/index.html?lang=de&download))
{slider=Lernfragen zu: Häufigkeit von COPD- Exazerbationen reduzieren}
Die Häufigkeit von COPD- Exazerbationen kann reduziert werden durch:
{slider=Antwort zu: Häufigkeit von COPD- Exazerbationen reduzieren}
Antwort 3 ist falsch:
obwohl vereinzelte Studien unter einjähriger prophylaktischer Gabe von Zithromax® etwas weniger Exazerbationen gesehen haben, war dies bei den Weiterrauchenden nicht der Fall [8]).
{slider=Bibliografie}
[1] Downs SH, Schindler Ch, Liu L-JS et al: Reduced exposure to PM10 and attenuated age-related decline in lung function. N Engl J Med 2007; 3572338-2347.
[2] Dusemund F; Baty F, Brutsche MH: Significant reduction of AECOPD hospitalisations after implementation of a public smoking ban in Graubünden, Switzerland. Tob Control 2015; 24: 404-407.
[3] Anthonisen NR, Skeans MA, Wise RA et al: The effects of a smoking cessation intervention on 14.5- Year mortality. Ann Intern Med 2005; 142:233-239.
[4] Woodruff PC, Barr RG, Bleecker E et al: Clinical significance of symptoms in smokers with preserved pulmonary function. New Engl J Med 2016; 374: 1811-1821.
[5] Dransfield MT, Kunisaki KM, Strand MJ et al: Acute Exacerbations and lung function loss in smokers with and without COPD. Am J Respir Crit Care Med 2016: DOI: 10.1164/rccm.201605-1014OC.
[6] Strassmann A, Steurer-Stey C, Dalla Lana K et al: Population-based reference values for the 1-min sit-to-stand test. Int J Public Health 2013; 58: 949–953.
[7 ] Meier C, Mörgeli H, Büchi S et al: Psychische Belastung und Lebensqualität bei COPD-Patienten und bei deren Partnern. Praxis 2011;100:407–415.
[8] Han MK, Tayob N, Murray S et al: Predictors of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Exacerbation Reduction in Response to Daily Azithromycin Therapy. Am J Respir Crit Care Med 2014;189:1503–150.
{slider=Abbildungen}
Abb1. Die Zahl der Todesfälle an COPD nimmt vor allem bei den Frauen zu (Angaben Bundesamt für Statistik BFS, Neuenburg, 2016)
Abb2. Zeigen Sie dieses Bild Ihren Patienten: Rauchstopp ist die wirksamste Massnahme gegen den Verlust von Vitalkapazität (mit freundlicher Genehmigung durch Prof. N. Küenzli, STPH Basel)
Abb3. Die Betreuung von COPD- Kranke ist ebenso dankbar wie die von Hypertonikern
Abb4. Aktivitätsmessung hilft als Motivation zum regelmässigen Training
{slider=Abkürzungen}
COPD: chronische obstruktive Lungenkrankheit; FEV1: forciertes exspiratorisches Einsekundenvolumen; GOLD: Global initiative for chronic Obstructive Lung Disease
{/sliders}
Korrespondenzadresse
Dr. Otto Brändli, Hömelstrasse 15, 8636 Wald; Kontakt zu Otto Brändli

Medienmitteilung Download ![]() pd_swisstb_award_2017.pdf839.12 KB
pd_swisstb_award_2017.pdf839.12 KB
Der Kampf gegen die Tuberkulose geht weiter
Zusammen mit Aids ist Tuberkulose noch immer die häufigste tödliche Infektionskrankheit weltweit. Die Erforschung neuer Mittel und Wege zur Bekämpfung der Tuberkulose ist nach wie vor von zentraler Bedeutung. Die Schweizerische Stiftung für Tuberkuloseforschung vergibt deshalb auch dieses Jahr den mit CHF 10'000 dotierten swissTB-Award. Die Preisträger, Dr. Paul Murima und Dr. Michael Zimmermann, haben die Stoffwechselregulation des Tuberkulose-Bakteriums erforscht, um neue Therapiemöglichkeiten zu entwickeln. Ein Sonderpreis in der Höhe von CHF 1000 geht an Kathrin Zürcher für die historische Aufarbeitung der Zusammenhänge zwischen der Tuberkulose und den Wohn- und Lebensbedingungen in der Stadt Bern.
„Unsere Arbeit eröffnet die Möglichkeit, die Stoffwechselregulation der Tuberkulose-Bakterien spezifisch zu stören und das könnte in Zukunft zur antibakteriellen Therapie der Krankheit genutzt werden”, fassen Dr. Paul Murima und Dr. Michael Zimmermann ihre Forschungsarbeit zusammen. Diese Arbeit wird aus Anlass des WeltTuberkulose-Tags ausgezeichnet: Die beiden Wissenschaftler erhalten den mit CHF 10'000 dotierten swissTBAward, mit dem die Schweizerische Stiftung für Tuberkuloseforschung seit 2002 die besten Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Tuberkulose auszeichnet.
Media Release:
Source: AnnalsATS Volume 13 Number 4| April 2016
a very positive report on our commitment in Ethiopia just published in the American Journal pulmonologists.
Our project has become a model for all of Africa!
Download Article:
![]() Annals-of-the-ATS-article.pdf446.87 kB
Annals-of-the-ATS-article.pdf446.87 kB![]() Editorial-re-EATI.pdf417.74 kB
Editorial-re-EATI.pdf417.74 kB


Medienmitteilung Download ![]() pd_swisstb_award_2016.pdf 433.3 kB
pd_swisstb_award_2016.pdf 433.3 kB
Entwicklung neuer Impfstoffe im Fokus
Die Tuberkulose ist weltweit jedes Jahr noch immer für mehr als drei Millionen Todesfälle verantwortlich; neue Ansätze zur Bekämpfung dieser Infektionskrankheit sind gefragt. Seit 2002 unterstützt die Schweizerische Stiftung für Tuberkuloseforschung swissTB deshalb die Erforschung der Tuberkulose mit dem swissTB-Award. Den diesjährigen Preis, dotiert mit CHF 10'000, erhält Dr. Mireia Coscolla Devis, Wissenschaftlerin am Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut, für ihre Arbeiten zur Antigenvariation der Tuberkulose-Bakterien. Einen Spezialpreis in der Höhe von CHF 1000 erhält Christian Schürer für seine Dissertation „Der Traum von Heilung“.
Die diesjährige Preisträgerin, Dr. Mireia Coscolla, arbeitet als Wissenschaftlerin am Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut (Swiss TPH). Im Rahmen der nun ausgezeichneten Arbeit beschäftigte sie sich mit den Antigenen des Tuberkulose-Bakteriums.1 Als Antigene werden die „Erkennungsmerkmale“ von Krankheitserregern bezeichnet. Die meisten Krankheitserreger ändern ihre Antigene ständig, um so den vom Immunsystem gebildeten Antikörpern zu entgehen; zwischen Immunsystem und Krankheitserregern herrscht ein eigentliches Wettrüsten. Zusammen mit Wissenschaftlern der Universität New York konnten Dr. Coscolla und ihr Team um Sébastien Gagneux nun zeigen, dass sich das Tuberkulose-Bakterium im Hinblick auf die Antigene anders verhält: Ihre Variation ist im Gegensatz zu anderen Krankheitserregern gering. Anders als zu erwarten ist dies für den Tuberkulose-Erreger ein Vorteil: Das menschliche Immunsystem reagiert auf die hoch konservierten Antigene äusserst heftig. Diese Immunreaktion führt zu einem starken Krankheitsbefall der Lunge, was durch den hervorgerufenen Husten wiederum die Übertragung der Krankheit auf andere Menschen begünstigt.
Medizinerin Regula Rapp für ihr Lebenswerk ausgezeichnet
Die Schweizerische Aerosol Gesellschaft (SAG) verleiht dieses Jahr zwei Preise. Sie ehrt die Umwelt-Pionierin Regula Rapp für ihren langjährigen Einsatz zur Luftreinhaltung in der Schweiz. Der Preis ist mit 5'000 CHF dotiert. Er wird heute zusammen mit dem Schweizer Aerosol Preis für die beste Publikation auf dem Gebiet der Schadstoff-Forschung an der Jahrestagung der SAG in Bern verliehen.
Die Schweizerische Aerosol Gesellschaft verleiht zum ersten Mal einen Preis für ein Lebenswerk. Die Umwelt-Pionierin Regula Rapp wird für ihren unermüdlichen Einsatz zur Verbesserung der Luftqualität in der Schweiz geehrt. «Regula Rapp sammelte und bewertete die weltweite Forschungsliteratur zur Luftverschmutzung wie keine andere vor ihr und machte die Resultate einer breiten Bevölkerung zugänglich» begründet Otto Brändli, Präsident des Wahlgremiums, die Entscheidung.
Read more: Medizinerin Regula Rapp für ihr Lebenswerk ausgezeichnet
Wald, 18.11.2013
Medienmitteilung Download ![]() Swiss-Aerosol-Award-2013.pdf107.53 kB
Swiss-Aerosol-Award-2013.pdf107.53 kB
Swiss Aerosol Award 2013: Neues Messgerät für Nanopartikel
Nanopartikel sind Teilchen mit weniger als 100 Nanometern; sie sind also kleiner als 100 Millionstel Meter. Diese Winzlinge sind aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken; umso wichtiger ist die Erforschung ihrer Wirkungen und Nebenwirkungen. Der diesjährige mit CHF 10'000 dotierte Swiss Aerosol Award geht an eine Doktorandin der ETH Zürich, die ein neuartiges Gerät zur Messung und damit zur Erforschung von Nanopartikeln entwickelt hat.
Read more: Swiss Aerosol Award 2013: Neues Messgerät für Nanopartikel
Wald 22.11.2012
Medienmitteilung Download ![]() KVA-Studie-fuer-SwissLung-WALSER.pdf285.44 kB
KVA-Studie-fuer-SwissLung-WALSER.pdf285.44 kB
Tobias Walser und Ludwig Limbach sind die Gewinner des Swiss Aerosol Award 2012
An der 7. Jahresversammlung der Swiss Aerosol Group in Bern wurde am 20.11.2012 der jährlich von der Swiss Lung Fundation gesponserte Swiss Aerosol Award den beiden ETHZ Mitarbeitern für ihre bahnbrechende Arbeit verliehen: Synthetische Nanopartikel werden heute in Megatonnen hergestellt und in eine Vielzahl von Industrie- und Konsumprodukten verarbeitet. Nach dessen Nutzung werden diese Produkte hauptsächlich in Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) verbrannt. Bisher wurden noch keine Untersuchungen dazu gemacht, was mit nano-funktionalisierten Produkten am Ende ihres Lebenszyklus geschieht. Werden die synthetischen Nanopartikel aus dem Rauchgas herausgefiltert, bevor sie in die Umwelt gelangen können? Und wie verteilen sich die Nanopartikel auf die verschiedenen Verbrennungsprodukte in der KVA?? Diese Fragen wurden von Tobias Walser und Ludwig Limbach gemeinsam angegangen.
Read more: Swiss Aerosol Award 2012: Nanopartikel in der Kehrichtverbrennungsanlage
SwissTB-Award 2012:
Download als PDF: ![]() PD_SwissTB-Award_2012.pdf471.07 kB
PD_SwissTB-Award_2012.pdf471.07 kB
Neue Forschung im Kampf gegen die Tuberkulose
Seit zwölf Jahren vergibt die schweizerische Stiftung für Tuberkuloseforschung SwissTB jährlich am Welt-Tuberkulose-Tag einen Preis in der Höhe von CHF 10'000 für eine Forschungsarbeit auf dem Gebiet der Tuberkulose. Der SwissTB-Award geht 2012 einerseits an den Grundlagenforscher Ruben C. Hartkoorn von der ETH
Lausanne, andererseits an den klinischen Forscher Lukas Fenner vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern. Mit beiden Forschungsarbeiten wird ein wichtiger Beitrag zur besseren Erforschung – und damit zur besseren Bekämpfung – der Tuberkulose geleistet, die weltweit nach wie vor auf dem Vormarsch ist.
„Wir hatten zahlreiche hochkarätige Einsendungen für den SwissTB-Award 2012“, freut sich Dr. med. Otto Brändli, Präsident der schweizerischen Stiftung für Tuberkuloseforschung SwissTB. „Die Auswahl ist uns nicht leicht gefallen. Schliesslich haben wir uns entschieden, das Preisgeld aufzuteilen und einerseits eine Arbeit aus der Grundlagenforschung, andererseits eine klinische Forschungsarbeit zu berücksichtigen.“ So werden sowohl Ruben C. Hartkoorn von der ETH Lausanne als auch Lukas Fenner vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern ausgezeichnet. Die Preisübergabe findet am diesjährigen Welt-Tuberkulose-Tag vom 21. März 2013 im Rahmen des Tuberkulose-Symposiums der Lungenliga Schweiz in Münchenwiler statt.
Read more: Swiss TB Award 2012 Medienmitteilung vom 21.03.2013
Page 3 of 5